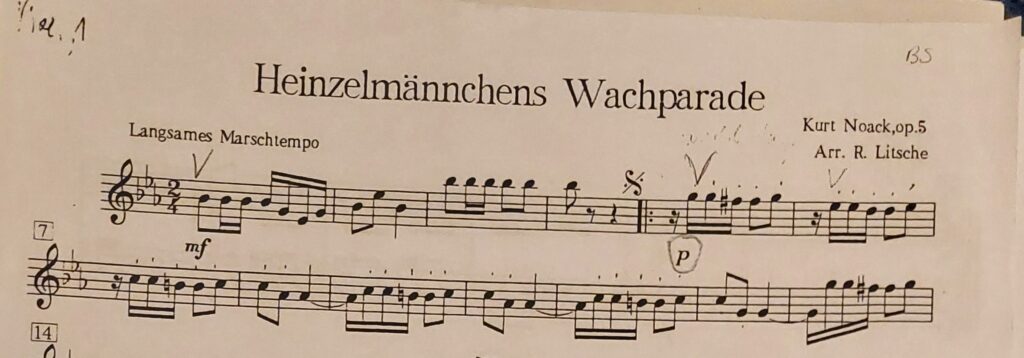Der Junge war ungefähr 12, damals, in den 1950er Jahren, als er zum Stromern in den Wald ging. Der Hund seines Onkels lief mit. Es war einer von den scharfen, die der Junge eigentlich nicht mochte. Aber so waren sie zu zweit.
Sie kamen zu den überwucherten Bunkern, diesen eilig gegrabenen und notdürftig befestigten Stellungen aus Zeiten, die der Junge noch im Ohr hatte. Ein Panzerwrack hatte den Kindern dort auch manchmal als Versteck gedient; inzwischen war die Tarnschicht aus Grasbüscheln und Zweigen zu einem Biotop geworden. Der Hohlraum darunter war seit Jahren feucht und stank.
Als der Junge nun feststellte, dass er schon mitten auf diesem Wrack stand, war es bereits zu spät. Sein rechtes Bein schrammte an unsichtbaren scharfen Kanten ins Bodenlose. Kurze Zeit hing der Junge fest, und die Kiefern schienen um ihn herum zu kreisen. Dann krachte er mit voller Wucht ins Dunkle hinunter.
Wie lange er dort zitterte, weiß er nicht. Doch entschloss er sich irgendwann, einen Versuch zu wagen hinauszukommen. Die Wunde an seinem Bein brannte wie die Hölle. Es gab aber Wege, die gekrochen werden konnten. Zur Not. Auch aus diesem Wrack hinaus. Als er schließlich auf dem Waldboden lag, war der Hund nicht mehr da.
Der zähnefletschende Gefährte hatte ihn verlassen!
Entsetzt schleppte sich der Junge ein paar Meter und lehnte sich an einen Baum. Es gab genügend Stämme zum Ausruhen. Seine Fleischwunde band er mit einem Taschentuch ab, der Schuh war schon voller Blut. Er durfte nicht hinschauen, sonst kippte er um. Einfach weiter. Immer weiter.
Irgendwann hörte er ein Bellen, sah das Tier an der straffen Leine und dann den Onkel, der kaum Schritt halten konnte und endlich kapierte, warum der Hund ihn in den Wald geholt hatte.
Nachkriegszeiten …